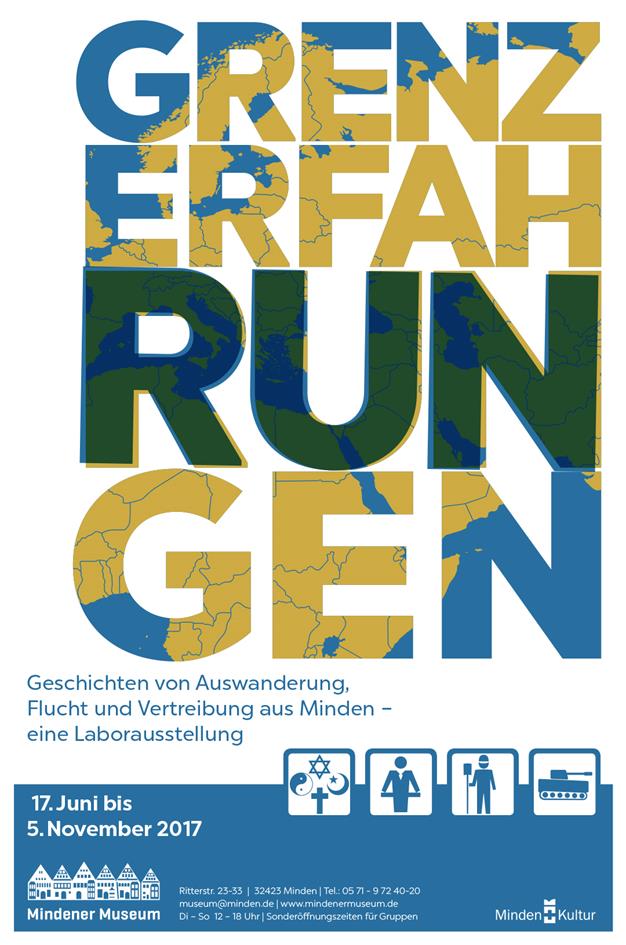20. Juni 2023

Aus Sicht des Flüchtlingsrat Niedersachsen ist der diesjährige Internationale Flüchtlingstag ein Tag der Trauer: Mit der GEAS-Reform hat die Bundesregierung sich von einer Politik verabschiedet, die die Europäische Menschenrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention zum unhinterfragbaren Maßstab für politische Entscheidungen erklärt. Im Rahmen des „Gemeinsamen europäischen Asylsystems (GEAS)“ ist die Unterbringung aller Asylsuchender in haftähnlichen Einrichtungen verpflichtend vorgesehen, auch in Deutschland. Im nächsten Schritt soll dann geprüft werden, welche Geflüchtete man ohne eine inhaltliche Prüfung der Asylgründe in sogenannte „sichere Drittstaaten“ abschieben kann, zu denen auch autokratische Staaten wie Tunesien oder die Türkei oder bitterarme Staaten wie Moldau gehören werden. Geflüchtete aus Herkunftsstaaten mit einer Schutzquote unter 20% (zu denen z.B. auch Asylsuchende aus der Türkei gehören werden) sollen auch dann bis zu drei Monaten in „haftähnlichen Einrichtungen“ bleiben, wenn eine Abschiebung in „sichere Drittstaaten“ nicht möglich ist – ihre Asylanträge sollen in Schnellverfahren innerhalb von drei Monaten abgewickelt werden. Die Dublin-Überstellungsfrist soll auf 12 Monate verlängert werden.
Auslöser für diese Maßnahmen ist die angeblich so hohe Zahl der Asylsuchenden: 125.000 Menschen haben in den ersten 5 Monaten des Jahres 2023 einen Asylerstantrag gestellt. Rund 25% der Antragsteller:innen sind allerdings hier geboren, also gar nicht zugezogen. Damit reduziert sich die Zahl der zugezogenen Asylsuchenden in dem Monaten Januar bis Mai 2023 auf rund 100.000 Menschen.
Das Problem ist nicht die Zahl: Händeringend wirbt die deutsche Politik um Arbeitskräfte im Ausland. Ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist auf den Weg gebracht, der Bedarf wird mit 400.000 Arbeitskräften im Jahr beziffert. Für sie stehen die Türen in Deutschland weit offen. Eine Million Geflüchtete aus der Ukraine waren der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2022 willkommen, und es gibt keinen Zweifel, dass die Opfer des russischen Angriffskrieges in Deutschland auch weiterhin willkommen sind. Ihre Aufnahme in Deutschland unterliegt keinen Beschränkungen oder Reglementierungen.
Eine menschenwürdige Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine war und ist eine Herausforderung: In dem Bestreben, die Aufnahme so einfach und pragmatisch wie möglich zu gestalten, hat sich die Politik entschieden, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu helfen, ihr Leben hier in Deutschland neu zu gestalten und private Hilfe in Anspruch zu nehmen: Ukrainer:innen dürfen sich selbst eine Unterkunft suchen, bei Freund:innen oder Unterstützer:innen unterkommen. Sie erhalten (im Unterschied zu Asylsuchenden) ein sofortiges Aufenthaltsrecht und dürfen sofort arbeiten. Die diskriminierenden Regelungen des Asyl- und des Asylbewerberleistungsgesetzes gelten für sie nicht.
Bei Asylsuchenden geht die Politik den umgekehrten Weg: Statt ihnen den Weg zu ebnen und die Aufnahme zu erleichtern, setzt die deutsche Politik auf weitere Abschottung und Reglementierung: In Tunesien und anderen Nachbarstaaten Europas wirbt die Bundesregierung für Migrationsabkommen, stellt Arbeitsvisa für den deutschen Arbeitsmarkt in Aussicht und verlangt dafür, dass Flüchtlinge daran gehindert werden, nach Europa zu fliehen. Wer es dennoch dorthin schafft, kommt zunächst einmal ins Lager. Begleitend dazu haben die Ministerpräsident:innen der Länder auf ihrer Konferenz im Mai darüber hinaus einen umfangreichen Katalog an weiteren gesetzlichen Verschärfungen gefordert, den die Bundesregierung umsetzen soll.
Das Problem ist also nicht die Zahl. Ziel der deutschen Politik ist es, Menschen für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen und die Handlungs-und Regulationskompetenz des Staates im Bereich der Migrationssteuerung zu vergrößern. Eine humanitäre Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine erfolgt vor dem Hintergrund des jahrzehntelangen Systemgegensatzes zwischen Ost und West und in nachvollziehbarer Empörung über den russischen Angriffskrieg schrankenlos, aber auch verpackt in die rassistische Begründung, dass ukrainische Geflüchtete uns „kulturell näher“ seien, in jedem Fall aber in der Erwartung, dass sie und aufgrund ihrer Qualifikationen eine Bereicherung für den deutschen Arbeitsmarkt darstellen würden. Hinten runter fallen die Verfolgten aus anderen Teilen der Welt. Das Mitleid ist aufgebraucht, für sie ist kein Platz mehr. Das Problem heißt Rassismus.
Text: Kai Weber
Geschäftsführer Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.